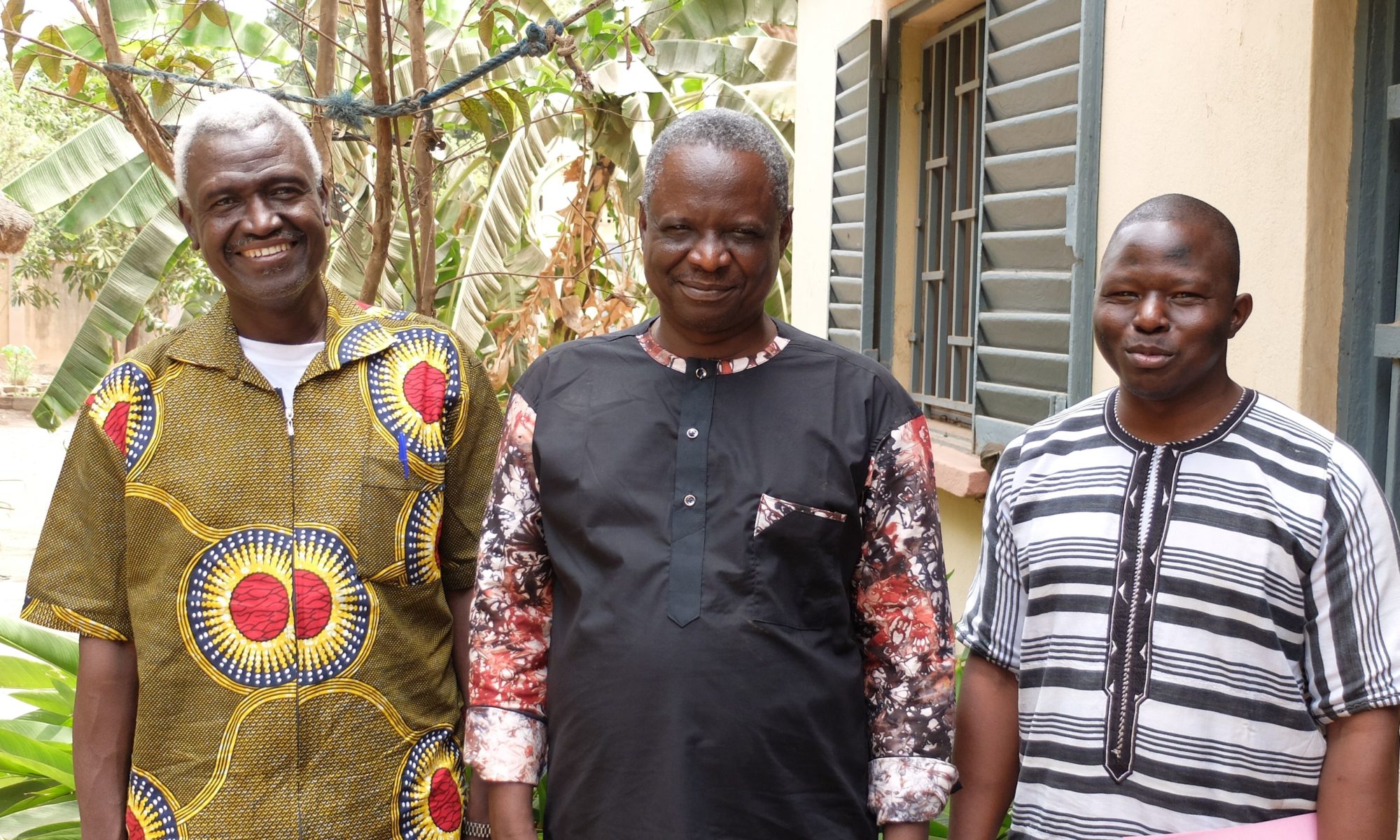Eigentlich sollten wir gerade dabei sein unsere Koffer für Mali zu packen.
Eigentlich säßen wir morgen um diese Zeit im Flugzeug nach Istanbul, um dann mitten in der Nacht in Bamako anzukommen.
Eigentlich hatten wir geplant zusammen mit 4 Freunden des Unterstützervereins „Radfahren für Mali“ vor Ort malische Partner zu besuchen, gemeinsam Gottesdienst in Bamako zu feiern, über Projekte zu sprechen.
Eigentlich waren wir davon ausgegangen, dass die Situation im Land es zwar nicht zulässt zu reisen, aber in Bamako die Sicherheit nicht wesentlich gefährdet ist.
Aber…
… es wird in der Hauptstadt immer schwieriger. Die Haupttransportwege vom Senegal oder der Elfenbeinküste werden von islamistischen Terroristen blockiert, Tanklaster in Brand gesetzt und so wird die Treibstoffversorgung in Bamako immer problematischer:
Menschen können nicht zur Arbeit fahren, die Dieselgeneratoren liefern keinen Strom mehr, die Schulen und Universitäten mussten schließen, vor den Tankstellen bilden sich riesige Schlangen, um den einen oder anderen Liter Benzin abzubekommen, der sonst so chaotische Straßenverkehr kommt teilweise zum Erliegen.

Es ist eine perfide Strategie der Terroristen: entweder irgendwo in Wäldern versteckt oder unter die Bevölkerung gemischt, steigen sie auf ihre Motorräder, überfallen ausgerüstet mit Kalaschnikows die LKW- und Tanklaster-Konvois, zünden alles an, verschwinden wieder und sind so kaum vom malischen Militär aufzuhalten.
Vor wenigen Tagen haben dann zahlreiche Botschaften ihre Landsleute angewiesen das Land schnellstmöglich zu verlassen, weil nicht absehbar ist, wie sich die Lage weiter entwickelt, auch das Kerosin für die Flugzeuge wird knapp… Manuel Müller, der erst vor wenigen Wochen nach einem mehrmonatigen Deutschlandaufenthalt nach Mali zurückgekehrt ist, musste schon wieder in einen Flieger zurück nach Deutschland steigen.
Und jetzt? Wir beten – zusammen mit unseren malischen Freunden – dafür, dass sich die Lage wieder bessert und zumindest Karsten zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr doch noch fliegen kann. Wir beten, dass die Pläne der Islamisten nicht aufgehen, dass die Bevölkerung weiter gelassen bleibt (wir sind immer wieder beeindruckt, mit welch großer Resilienz Malier solche Krisen wegstecken!), die Regierung und das Militär Möglichkeiten finden, die Blockade Bamakos und anderer Städte in den Griff zu bekommen. Und auch wenn die große Mehrheit der Malier diesen liebenden Gott und Seinen Sohn Jesus Christus nicht kennen, hoffen wir auf Sein Eingreifen!