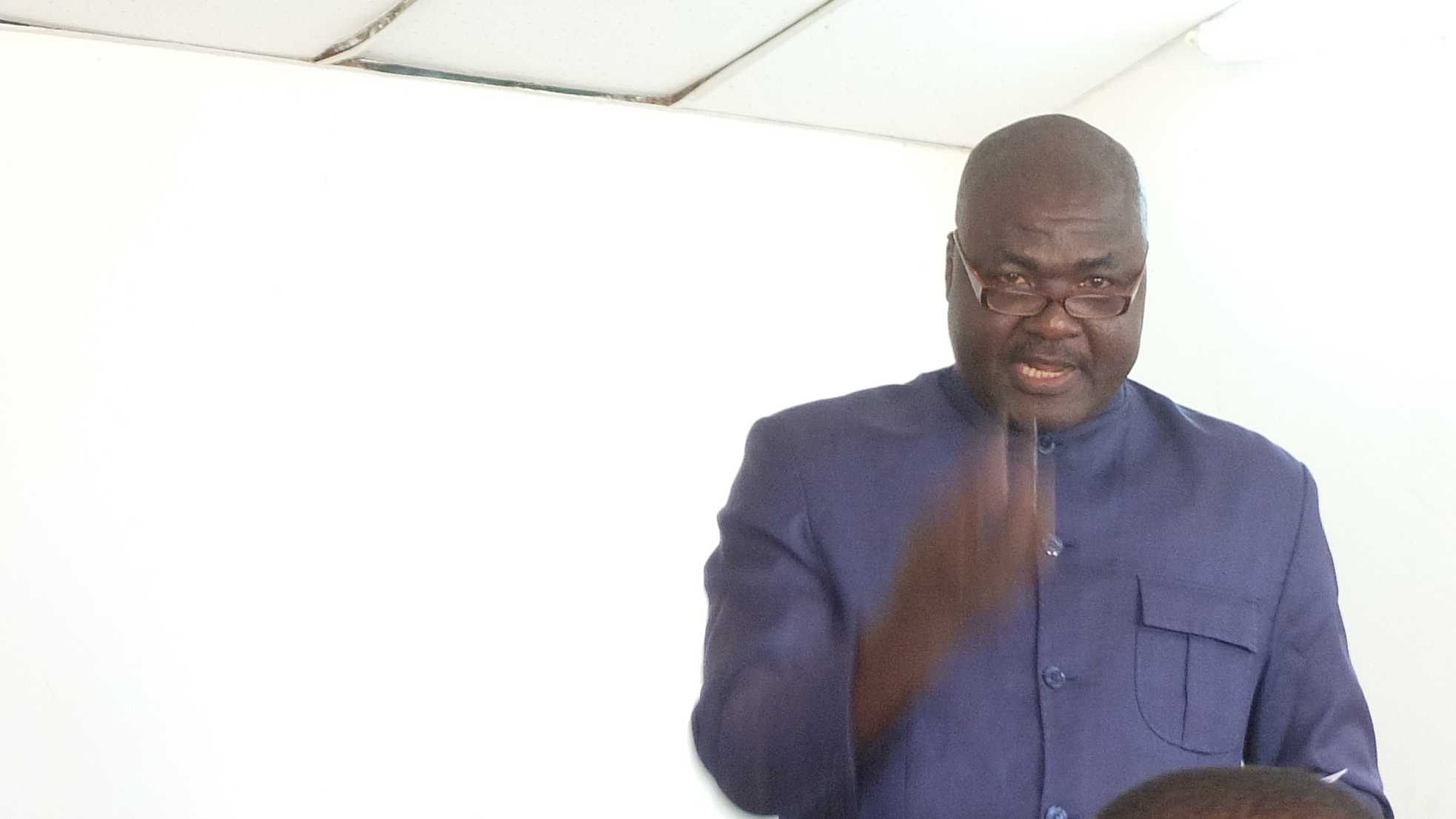Zweimal haben wir schon berichtet von diesem Projekt (19.11.19 und 19.03.20), das seit Jahren im Sénégal junge Leute in nachhaltiger Landwirtschaft ausbildet und sie gleichzeitig trainiert ihr Leben im Vertrauen auf Gott zu gestalten. Auch haben wir berichtet, dass hier seit ein paar Jahren daran gearbeitet wird, ebenfalls auf malischem Boden ein ähnliches Projekt aufzubauen. Und es geht weiter: Der erste Schritt ist, ein passendes Grundstück zu finden. Das geht so, dass man sich mit ein paar Dörfern verständigt, die dem Projekt von ihrem Umland einen Teil überlassen. Dazu sind lange Verhandlungen nötig, denn Grund und Boden sind ein zentrales Gut, das nicht mal eben so den Besitzer wechselt, sondern im ländlichen Bereich von einer Generation an die andere weiter gegeben wird. Daher heißt es erst einmal, die Menschen aus den Dörfern überzeugen, dass ihnen ein solches Projekt auf verschiedene Weise Nutzen bringt: junge Leute finden Arbeit, Bäume verändern das Mikroklima, eine Tiefbohrung bringt gutes Trinkwas ser, viel verschiedenes Gemüse, Obst, Fleisch kann sozusagen nebenan gekauft werden und man braucht dafür nicht mehr weit zu fahren und auch von den Einkünften des Projektes bekommt das Dorf einen Anteil. Beide Seiten profitieren und wenn man übereinkommt, dann wird so eine Art Pachtvertrag geschlossen – das Grundstück wird nicht verkauft, sondern unter definierten Bedingungen für eine gewisse Zeit (in unserem Fall 45 Jahre) dem Projekt zur Verfügung gestellt – und es geht hier nicht um einen „Handtuchgarten“ hinterm Haus, sondern um über 50 Hektar.
ser, viel verschiedenes Gemüse, Obst, Fleisch kann sozusagen nebenan gekauft werden und man braucht dafür nicht mehr weit zu fahren und auch von den Einkünften des Projektes bekommt das Dorf einen Anteil. Beide Seiten profitieren und wenn man übereinkommt, dann wird so eine Art Pachtvertrag geschlossen – das Grundstück wird nicht verkauft, sondern unter definierten Bedingungen für eine gewisse Zeit (in unserem Fall 45 Jahre) dem Projekt zur Verfügung gestellt – und es geht hier nicht um einen „Handtuchgarten“ hinterm Haus, sondern um über 50 Hektar.
Bei den Gesprächen mit dem Dorf Bougoula, ca. 1,5 Autostunden von Bamako entfernt, wurde deutlich, dass ein wirkliches Verstehen und Übereinkommen nicht von heute auf morgen machbar ist und so entschloss man sich, mit einer Delegation aus dem Dorf in den Sénégal zu fliegen, damit sie dort sehen können, wie ein solches Projekt funktioniert und auch, wie die Nachbardörfer davon profitieren.
Schließlich kam man überein und bei unserem letzten Besuch hatten wir die Möglichkeit, das Grundstück zu besichtigen und die Leute aus dem Dorf ein bisschen kennen zu lernen. Zuerst wollten sie mit uns das komplette Areal abschreiten, aber bei – wie gesagt – über 50 Hektar haben wir dann doch höflich verzichtet und uns mit einem Blick auf zwei Grenzsteine zufrieden gegeben.
Möglichkeit, das Grundstück zu besichtigen und die Leute aus dem Dorf ein bisschen kennen zu lernen. Zuerst wollten sie mit uns das komplette Areal abschreiten, aber bei – wie gesagt – über 50 Hektar haben wir dann doch höflich verzichtet und uns mit einem Blick auf zwei Grenzsteine zufrieden gegeben.
Mittlerweile ist das ganze Grundstück umzäunt und eine Tiefbohrung mit Solarpumpe installiert. Eigentlich könnte es jetzt richtig losgehen, aber so einfach ist es dann doch nicht: trotz schriftlicher Vereinbarungen kommt es immer wieder zu Missverständnissen und Ansprüchen aus dem Dorf, die wir gestern im Kreis der Vereinsmitglieder lange diskutiert haben: ein Wächter wurde gebraucht und schwupp stand ein  junger Mann aus dem Dorf auf der Matte und sie gingen davon aus, dass es ihr gutes Recht sei, ohne Rücksprache jemanden für diesen Job zu bestimmen. Da sie dann auch gleich das Gehalt festlegten, was so ca. 300% von einem normalen Wächtergehalt betrug, wurden die Motive schnell klar. Wie aber damit umgehen? Wie kann man deutlich machen, dass man sich nicht über den Tisch ziehen lässt aber gleichzeitig ein Vertrauensverhältnis aufbauen? Heftig wurden gestern die verschiedenen Meinungen diskutiert und in der nächsten Woche fährt eine Delegation ins Dorf, um dort zu verhandeln. Die Kuh ist noch nicht vom Eis, würde man in Deutschland sagen, was aber hier bei 40°C wirklich nicht viel Sinn macht.
junger Mann aus dem Dorf auf der Matte und sie gingen davon aus, dass es ihr gutes Recht sei, ohne Rücksprache jemanden für diesen Job zu bestimmen. Da sie dann auch gleich das Gehalt festlegten, was so ca. 300% von einem normalen Wächtergehalt betrug, wurden die Motive schnell klar. Wie aber damit umgehen? Wie kann man deutlich machen, dass man sich nicht über den Tisch ziehen lässt aber gleichzeitig ein Vertrauensverhältnis aufbauen? Heftig wurden gestern die verschiedenen Meinungen diskutiert und in der nächsten Woche fährt eine Delegation ins Dorf, um dort zu verhandeln. Die Kuh ist noch nicht vom Eis, würde man in Deutschland sagen, was aber hier bei 40°C wirklich nicht viel Sinn macht.
Beerscheba – der Grundgedanke ist wirklich klasse und im Sénégal kann man sehen, dass es funktioniert. Wir beten dafür, dass die vielen Stolpersteine in Mali Stück für Stück aus dem Weg geräumt werden können, damit auch hier junge Leute eine gesunde wirtschaftliche wie geistliche Basis für ihr Leben vermittelt bekommen können!
Und wer Lust hat, dieses Projekt zu unterstützen, der kann das tun, indem er Ehrenmitglied im Verein wird. Mit 91,50 Euro jährlich seid Ihr dabei und ich halte Euch auf dem Laufenden über die weiteren Entwicklungen. Wer macht mit? Einfach eine kurze Mail schreiben…